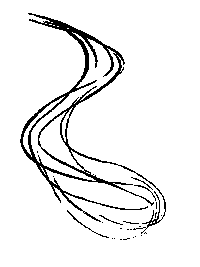|
||||||||||||
| ||||||||||||
| eine weiterführende Darstellung diese Themas finden Sie unter: Wolfgang Peter
Was fordert echte Schauspielkunst von uns, und was kann sie uns ganz persönlich geben? Sie verlangt von uns, in eine Rolle zu schlüpfen, sie glaubhaft zu verkörpern, und sie schenkt uns, wenn uns das halbwegs gelingt, Freude am Spiel, Befriedigung über das, was wir zustande gebracht haben – und nicht zuletzt zurecht den Applaus, die Anerkennung des Publikums, das sich seinerseits durch unsere Darstellung befriedigt fühlt. Wie aber kann man es anstellen, daß das gelingt? Damit, daß wir den Text einigermaßen sicher und ohne zu stocken herunterleiern, ist es wohl noch nicht getan, obwohl die Textsicherheit zweifellos die wichtigste Voraussetzung ist, um überhaupt an die Rollenarbeit heranzutreten. Das TextstudiumDie Gedächtnisbildung als Grundlage der kreativen ArbeitJe früher und je gründlicher man den Text beherrscht, desto besser ist es für die Probenarbeit. Ein einigermaßen freies Bühnenspiel kann sich erst entfalten, wenn man nicht mehr mit dem Textheft über die Bühne läuft, blind für alles, was um einen geschieht und taub für das, was die anderen Schauspielkollegen aus ihrer Rolle heraus zu sagen haben, weil man krampfhaft versucht, die Zeile in seinem Manuskript nicht zu verlieren. Außerdem kann man mit einem Text erst wirklich etwas anfangen, wenn man ihn in- und auswendig kennt. Wie aber stellt man das an?
Zuerst muß man sich einen verbindlichen Termin setzen, bis zu dem man den Text beherrschen muß, und der sollte nicht erst zwei Wochen vor der Premiere liegen, sondern so früh als möglich. Der Profischauspieler wird gezwungen, einen bestimmten Termin einzuhalten, und er hat es dadurch sogar leichter als der Amateur, der ihn ganz freiwillig einhalten muß – was aber soviel heißt, wie daß er sich selbst zwingen muß. Textstudium erfordert also möglichst eiserne Disziplin. Damit beginnt zugleich der eigentlich unangenehme Teil der ganzen Schauspielkunst, der aber dennoch einen wesentlichen Gewinn abwirft, den man nicht unterschätzen sollte: was man derart an Disziplin mühsam aufbringt, steht einem später als ganz reale schöpferische Willenskraft für das Rollenspiel zur Verfügung. Solange man noch mit dem Text hadert, wird das Spiel immer blaß und ausdruckslos wirken und einen selbst wenig erfreuen und befriedigen – das weiß wohl jeder, der schon einmal auf einer Bühne gestanden ist. Was man später an Freude gewinnen will, muß man erst durch Mühe erkaufen – daran führt kein Weg vorbei. Damit man den gesetzten Termin einhalten kann, muß man sich den Text in geeignete Portionen einteilen, die man gerade mit seiner Gedächtniskraft bewältigen kann. Das kann eine Seite sein, eine Szene, ganz nach den persönlichen Möglichkeiten. Gleichgültig ist es dabei, ob man jeden Tag ein Stückchen lernt oder lieber einmal wöchentlich eine größere Portion. Jeder wird selbst herausfinden, wie er am besten fährt. Nicht verzichten sollte man aber darauf, den gelernten Text einige Zeit lang möglichst täglich zu wiederholen. Das muß keineswegs der ganze Rollentext sein, sondern eben jene Portion, die man zuletzt studiert hat. Erfahrungsgemäß genügen dafür 10 bis 15 Minuten täglich – und die kann man in der Regel aufbringen, wenn man nur will, selbst wenn man ein sehr vielbeschäftigter Mensch ist und den Kopf mit hunderttausend anderen Dingen voll hat. Man muß regelrecht mit dem Text leben; und so wie wir auch regelmäßig essen müssen, sollte es uns ein regelmäßiges Bedürfnis werden, den Text zu wiederholen. Genau besehen wird man sich so den Text müheloser, rascher und mit insgesamt geringerem Zeitaufwand aneignen, weil man einfach effektiver vorgeht – und das ist in einer von Überfluß an Zeitmangel geprägten Zeit wie der unseren wohl auch nicht ganz unwichtig. Am besten wird man dabei vorankommen, wenn man den Text nicht zu einer beliebigen Zeit wiederholt, sondern täglich möglichst zum exakt gleichen Zeitpunkt. Das Gedächtnis läßt sich nämlich nur rhythmisch trainieren, und je strenger man den Rhythmus einhält, desto sicherer kommt man weiter. Sehr gute Erfahrungen wird man machen, wenn man den Text kurz vor dem Schlafengehen noch einmal durchgeht; dann nimmt man ihn nämlich in den Schlaf mit hinein, und erst im Schlaf festigt sich das Gedächtnis wirklich. Wenn man dann am nächsten Tag aufwacht und nochmals kurz den Text aus dem Gedächtnis aufsteigen läßt, wird man bald bemerken, daß er dann viel besser sitzt als am Abend zuvor. Überhaupt beherrscht man das Gelernte erst, wenn man es zwei oder drei Nächte überschlafen hat. Damit sich das, was man gelernt hat, wirklich einprägt, muß man es zeitweilig völlig im Unbewußten versinken lassen – und das gelingt eben am besten im Schlaf. Am schlechtesten ist es, wenn man krampfhaft versucht, das Erlernte möglichst beständig an der Oberfläche des Bewußtseins zu halten. Damit wird löscht man geradezu seine Gedächtnisfähigkeit aus. Man muß eigentlich beständig sein Bewußtsein vom Gelernten befreien, damit es dann aus der Tiefe des Unterbewußtseins um so souveräner wieder auftauchen kann.
Der Text wird sich umso leichter einprägen, je stärker man dabei als ganzer Mensch aktiv mitwirkt. Es genügt nicht, sich den bloß den Gedankengehalt, die begriffliche Ebene des Textes zu merken. Die ist sogar am unwesentlichsten und hindert uns oft daran, den getreuen Wortlaut in tieferen Schichten unseres Wesens zu verankern. Außerdem versteht man einen anspruchsvollen Rollentext, wenn man ehrlich ist, ohnehin nicht gleich. Das schadet aber gar nichts: irgendwann, wenn man den Text Wort für Wort verinnerlicht hat und ihn jederzeit mit schlafwandlerischer Sicherheit reproduzieren kann, wird sich beinahe von selbst das nötige Verständnis einstellen – und zwar viel gründlicher als das bei bloß oberflächlicher Textkenntnis möglich ist. Den Verstand sollte man also zunächst beiseite schieben und mehr auf den eigentlichen Wortlaut achten, was am besten gelingt, wenn man den Text laut sprechend memoriert – sofern das die häuslichen Mitbewohner ertragen können! Wenn man ihn aber schon nicht laut sprechen kann, etwa wenn man in der U-Bahn sitzt, dann muß man ihn zumindest leise innerlich mitsprechen. Nicht denken soll man den Text, sondern ihn sprechen. Man wird sich dann auch leichter vor einer großen Untugend des Textlernens befreien: wenn man den Text nämlich bloß inhaltlich studiert, wird man immer dazu neigen, ihn später zwar sinngemäß, aber nicht wortgetreu wieder aufleben zu lassen – und darauf kommt es gerade beim Schauspiel an. Die dichterische Qualität eines Stückes liegt ja vorallem in der Wortwahl und –abfolge, die der Dichter verwendet, und nicht ihm gedanklichen Gehalt; der ist nur der Rohstoff, dem der Dichter durch die gewählten Worte erst seine künstlerische Form gibt, und die muß uns ganz besonders am Herzen liegen. Den besten und schnellsten Erfolg wird man erzielen, wenn man während des Textstudiums auf- und abgeht und den dabei laut rezitierten Text auch noch mit ausladenden Gesten begleitet. Das mag zwar einen unbefangenen Beobachter mitunter recht komisch anmuten, aber man erreicht damit, daß sich der Text dem ganzen Gliedmaßensystem einverleibt – und erst dort sitzt er so richtig fest. Es ist nämlich durchaus ein moderner Aberglaube, daß das Gedächtnis bloß im Gehirn sitzt; wahr ist vielmehr, daß unser ganzer lebendiger Organismus an unserer Erinnerungsfähigkeit beteiligt ist, und je tiefer wir das Erlernte in unseren Leib versenken können, desto sicherer taucht es bei Bedarf aus dieser Tiefe wieder auf. Dabei darf man auch nicht glauben, daß das Gelernte so, wie wir es ursprünglich aufgenommen haben, "gespeichert" wird. Tatsächlich funktioniert unser Gedächtnis ganz anders als der digitale Speicher eines Computers. So simpel dieser verglichen mit dem Menschen ist, so kann er doch jederzeit hunderttausende Textseiten blitzschnell und getreu abrufen, was uns Menschen niemals gelingt. Unser Gedächtnis speichert nicht den gelernten Text, er ist als solcher nirgendwo in uns vorhanden, sondern durch das Lernen werden unserem Organismus gewissermaßen Spuren eingegraben, aus denen der Text später aktiv wieder rekonstruiert, nachgebildet werden muß. Daher erfordert ein getreues Gedächtnis auch viel Übung und Disziplin. Unser Gedächtnis, weil es das Erlernte immer wieder neu nachbilden muß, neigt sehr stark dazu, unsere Erinnerungen beständig zu verfälschen. Jedesmal, wenn wir etwas aus der Erinnerung heraufrufen, erscheint es schon wieder leicht verändert. Unsere Gedächtnisfähigkeit ist nämlich ganz eng verwandt mit unseren Phantasiekräften. Die Phantasie ist eigentlich nur eine gesteigerte und modifizierte Gedächtniskraft, und alles, was wir uns innerlich an phantasievollen Bildern vor die Seele zaubern, ist letztlich immer aus dem Rohmaterial unserer Erinnerungen gewoben. Wenn wir den Text getreu lernen wollen, was wir als Schauspieler unbedingt müssen, müssen wir uns vor jeder unbewußten Phantasterei hüten. Weil das Gedächtnis in unserem ganzen Organismus sitzt und nicht bloß im Gehirn, müssen wir das Erlernte auch mindestens zwei Nächte lang überschlafen, damit es sich wirklich fest in uns verankert. Am ersten Tag sitzt es nämlich tatsächlich noch vorallem im Kopfbereich. Nach der ersten Nacht rutscht es bereits in das rhythmische System, in die Atemtätigkeit und den Herzschlag hinunter, und erst nach der zweiten Nacht dringt es bis zu unserem Stoffwechsel- und Gliedmaßensystem vor. Wir müssen also das Erlernte geradezu im wörtlichen Sinne "verdauen", wir müssen es bis in die Verdauungsregion hinunterbringen, wo es, uns zunächst unbewußt, weiterlebt. Legt sich während des Gedächtnistrainings allzusehr der Verstand quer, verhindert man geradezu, daß das Erlernte genügend stark in den tieferen Regionen unseres Organismus weiterleben kann, wir halten es gleichsam krampfhaft in der Kopfregion fest, um es nur ja nicht wieder zu verlieren – und erreichen so das gerade Gegenteil: wir bekommen überhaupt keine Textsicherheit; der Text wird nur mühsam und kaum vollständig getreu rekonstruiert werden und auch kaum sehr lebendig, sondern eben konstruiert wirken. Man muß den Mut haben, das was wir lernen in der Tiefe unserer Organisation versinken zu lassen, es aus dem Bewußtsein zu entlassen und dem Unterbewußtsein anzuvertrauen, man muß es gleichsam zeitweilig bewußt "vergessen", d.h. aus dem Bewußtsein tilgen, und dem Leib anvertrauen. Von dort taucht es ganz sicher bei Bedarf frisch lebendig und ziemlich getreu wieder auf – und es wird dabei so spontan und ursprünglich wirken, wie wenn es uns gerade jetzt erst eingefallen wäre. Das ist aber gerade für den Schauspieler ganz wichtig, denn nur dann wirkt sein Rollentext echt und unmittelbar und nicht bloß eingelernt. Richtiges Rollenlernen ist damit hochbedeutsam für das spätere Rollenspiel! Und noch etwas verdanken wir der eigentümlichen Natur unseres Gedächtnisses: daß es eng mit den Phantasiekräften verwandt ist, macht es uns zwar nicht leicht, Rollen ganz getreu zu erlernen, aber es öffnet zugleich die Tore zu der Wunderwelt unserer kreativen Phantasie. Wenn der erlernte Text nur tief genug sitzt, wird es uns beinahe mühelos gelingen, ihn Wort für Wort getreu zu reproduzieren – aber wir werden ihn dabei jedesmal, wenn wir ihn sprechen, mit leicht verändertem Tonfall, mit etwas anderem Tempo und Rhythmus hervorbringen – hier spielt unsere Phantasie ganz unvermerkt und ohne, daß wir uns dabei anstrengen müssen, mit dem gesamten Lautbestand des Textes, variiert den Redefluß auf mannigfaltigste Weise und präsentiert uns dadurch ein ganze Panorama möglicher Gestaltungsformen. Wir brauchen eigentlich nur mehr darauf achten, bei welcher Gestaltung wir uns besonders wohl fühlen und der Rolle gemäß empfinden, und nach und nach wir uns so der Rollencharakter immer lebendiger werden. Wir brauchen diesen Charakter nicht mehr nach dem konstruieren, was wir uns über ihn denken, sondern er entsteht gleichsam immer deutlicher in uns. Und was so entsteht, wird uns auch immer mehr überraschen und vielleicht ganz und gar nicht dem entsprechen, was wir anfangs über die Rolle gedacht haben. Genau so muß es aber auch sein. Nicht wir sollen nach unseren Meinungen und Vorurteilen (und jede Meinung, und wenn es auch die beste und gescheiteste ist, ist notwendig zugleich ein einseitiges Vorurteil) einen Rollencharakter aufbauen wollen, sondern wir müssen den Freiraum in uns schaffen, in dem er seiner Natur gemäß lebendig werden kann. Sonst spielen wir doch nur immer wieder uns selbst in leicht modifizierter Form – und dann sind wir eigentlich bereits keine Schauspieler mehr. "Der Schauspieler irrt, wenn er glaubt, seine Rolle mittels persönlicher Gefühle darstellen zu können. Nicht immer macht er sich klar, daß seine persönlichen Gefühle nur über ihn selbst etwas aussagen, niemals über seine Rolle." (Cechov, S 125) Wir sollen eine Charakter verkörpern, d.h. wir sollen ihm zum Zweck des Bühnenspiels unseren Körper leihen, damit er für das Publikum sichtbar werden kann; aber seelisch soll sich darin eben dieser uns vielleicht seelisch ganz und gar nicht verwandte Charakter ausdrücken – und nicht wir selbst. Wir selbst dürfen gleichsam nur als aufmerksamer, aber völlig schweigsamer Beobachter daneben stehen. Das wird aber dann zugleich ein ganz besonderer Gewinn für uns sein. Denn wenn es sich auch bei der Rolle um einen mehr oder weniger fiktiven Charakter handelt, so ist er doch, wenn er nur von einem halbwegs guten Dichter geschaffen wurde, soviel vollsaftig Menschliches, daß wir nun geradezu die Chance haben einen anderen Menschen ganz von innen her kennenzulernen, bis in die intimsten Tiefen seiner Seele, während man im alltäglichen Leben andere Menschen nur von außen her kennenlernen kann und ihr Inneres mehr oder weniger aus ihrer Mimik, Gestik, Sprache usw. erahnen muß. Wir erleben dann hautnah, wie verschieden eigentlich Menschen sein können, wie man die Welt eigentlich auch noch von einem völlig anderen Standpunkt aus betrachten kann, der vielleicht unserem geradezu entgegengesetzt ist. Das kann sehr heilsam sein, denn erfahrungsgemäß glauben die meisten Menschen unbewußt ganz fest daran, daß überhaupt nur ein Standpunkt möglich ist – nämlich der eigene! Indem man so in sich geradezu einen zweiten, völlig eigenständigen Menschen bewußt mit sich herumträgt, lernt man zugleich sich selbst notwendig besser kann. Man lernt geradezu, sich selbst aus der Perspektive dieses anderen Menschen zu betrachten, und man wird dadurch unweigerlich an sich selbst Seiten entdecken, die einem vorher gar nicht bewußt waren. Das ist ein schönes und schreckliches Erlebnis zugleich. Schön, weil wir so manche Fähigkeit und Tugend in uns wecken können, die verborgen in uns schlummert; schrecklich, weil aber auch so mancher versteckte Mangel offenbar wird. Wie bei allen Menschen ist auch unser Wesen recht bunt aus Tugend und Mängel gemischt – und die Mängel, die wir uns bewußt eingestehen, sind normaler gar nicht die wichtigsten. Darum scheuen sich auch viele wie der Teufel vor dem Weihwasser, sich auf eine Rolle voll einzulassen – denn dann läuft man zwangsläufig Gefahr, sich selbst ungeschminkt betrachten zu müssen, und das kann natürlich auch manchmal recht ungemütlich werden. "Und der Mensch versuche die Götter nicht, und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen." – könnte man mit Schiller sagen und damit die geheime Lebensmaxime vieler Menschen treffend bezeichnen. Wer aber wirklich Schauspieler im modernen Sinne sein will, kann gerade dem nicht entkommen. Darum gibt es auch wenig wirklich gute Schauspieler und viel mehr, die sich mehr oder weniger gut mit ihrer persönlichen Masche durchlavieren! Jedenfalls sollte man als Schauspiel nicht vollkommen überrascht sein, wenn es zu so einer unvermuteten Selbstbegegnung kommt, und man sich darüber klar sein, daß die uneingestandene Angst davor oft der entscheidende Grund sein kann, warum man in seiner Rollengestaltung nicht weiterkommt. Nebenbei, so unangenehm eine derartige unverhüllte Selbsterkenntnis auch sein mag, schaden kann sie nicht, sondern höchstens auch für das alltägliche Leben nützen. Ehrlich betriebene Schauspielkunst hat halt immer auch einen gewissen autotherapeutischen Effekt und ist vielleicht manchmal besser und jedenfalls preiswerter, als sich beim Psychiater auf die Couch zu legen! Die Arbeit an der Rolle
Alle bewußte schauspielerische Arbeit ist ein Weg der Selbsterkenntnis, aber zugleich auch ein Weg der Selbstüberwindung. Je länger und intensiver man an einer Rolle arbeitet, desto eigenständiger und lebendiger wird sich der Rollencharakter in unserer Seele vergegenwärtigen und als selbstständige Persönlichkeit neben unseren Alltagsmenschen hintreten. Zwei Personen leben dann sozusagen in uns, die wir ganz klar auseinanderhalten müssen. Wenn immer sich diese zwei Personen in uns vermischen, wird das schlimme Folgen haben. Entweder kommen wir bloß wieder zur reinen Selbstdarstellung, oder, schlimmer noch, der Rollencharakter beginnt sich in unser normales alltägliches Dasein einzumischen. Man darf sich niemals mit seiner Rolle »identifizieren« wollen, auch wenn man das oft naiverweise als geradezu charakteristisch für gutes Rollenspiel annimmt. Der eigene Alltagsmensch muß stets neben und völlig getrennt vom Rollencharakter bestehen bleiben! Manchen Schauspieler, die für ihr exzessives Spiel bekannt sind, ist das nicht genügend gelungen; sie haben zwar oft großartig gespielt, aber sie sind persönlich daran zerbrochen (Musterbeispiele etwa: Romy Schneider oder Oskar Werner). Unser höheres ICH, wie es Cechov nennt, das Über-Ich im Sinne Freuds, muß sich sowohl über unsere Alltagspersönlichkeit als auch über den Rollencharakter stellen, beide streng auseinanderhalten, und jeweils frei entscheiden, wer von beiden sich gerade ausleben darf, welche sozusagen gerade den gemeinsamen Körper benutzen darf. Die Zeit, wo man noch aus dem »Bauch« heraus, aus der eigenen unmittelbaren Emotion, aus dem naturgegebenen instinktiven, aber darum auch unbewußten Talent heraus spielen konnte, ist eigentlich schon abgelaufen. "So, wie ein Maler beispielsweise außerhalb des Materials steht, das er für die Realisierung seiner Bilder benützt, stehen auch Sie, der Schauspieler, bei inspiriertem Spiel außerhalb des Leibes und außerhalb der schöpferischen Emotionen. Sie stehen über sich." (Cechov, S 122) Was also müssen wir tun, um eine Rolle verkörpern zu können? Wir haben den Rollencharakter als eigenständige seelische Persönlichkeit in uns, neben unserer eigen, und diese selbstständige Rollenpersönlichkeit muß unseren Körper benutzen, um sich dem Publikum zu zeigen – nur ist dummerweise dieser Körper, wie könnte es auch anders sein, unserer eigenen Alltagsperson angepaßt und meist ganz und gar nicht dem Rollentypus. Folglich muß sich unser ganzer Körper ändern! Zwar wird man als kleinwüchsiger Schauspieler nicht plötzlich zum Hünen werden können, und die wenigsten werden für eine Rolle 20 kg zu- oder abnehmen wollen – aber das ist auch gar nicht nötig. Nicht, wie groß, schwer, dick oder dünn der Körper ist, gibt den Ausschlag (obwohl man darauf natürlich in gewissen Grenzen bei der Rollenbesetzung achten muß), sondern seine innere und äußere Beweglichkeit. Der Bewegungsgestalt, dem Bewegungsmuster des Körpers muß der Rollencharakter aufgeprägt werden. Wir müssen dazu unsere eigenen, von Kindesbeinen an entwickelten inneren und äußeren Bewegungsformen so vollständig als möglich überwinden und durch andere ersetzen. Die ganze Bewegungsgestalt muß vollkommen verwandelt werden. Der Begriff "Bewegungsgestalt" muß dabei denkbar weit gefaßt werden, er beginnt nämlich bereits bei der inneren Denkbewegung. Unsere Meinung, unsere Gedanken, unser Verstand, sind für den Rollencharakter völlig unwesentlich, ja störend. Das ist sogar die erste und schwerste Hürde, die wir zu überwinden haben, denn gerade durch unser Denken, mit dem wir uns ganz besonders identifizieren, klammern wir uns ganz fest an uns selbst und machen es uns sehr schwer, uns von uns selbst zu befreien. Gerade im Denken machen wir uns nur allzuleicht zum Gefangenen unserer selbst. Solange wir uns an unseren Gedanken festhalten, solange werden wir wahrscheinlich überhaupt verhindern, daß der Rollencharakter als selbstständige Persönlichkeit neben unserer eigenen aufkommen kann, und noch weniger wird es uns gelingen, diese neue, fremde Persönlichkeit unseren Körper ergreifen zu lassen. Denn der Verstand macht uns nicht nur zu Gefangenen unserer selbst, sondern er fesselt noch dazu unserer Persönlichkeit an den Kopf und verkrampft den restlichen Leib mehr oder weniger. Wer halbwegs aufmerksam beobachten kann, wird leicht bemerken, daß ausgesprochene einseitige Verstandesmenschen körperlich sehr ungeschickt, oft geradezu hölzern sind. "Bei geistiger Arbeit beobachtet man ... eine Zunahme des Energieumsatzes. Diese ist nur zum geringeren Teil durch die Mehrarbeit des Gehirns bedingt. Der größte Teil der Zunahme rührt von einer erhöhten Grundanspannung der Körpermuskulatur her." (Schmidt, S 133) Wenn sich durch die Verstandestätigkeit die Körpermuskulatur verspannt, wird die Gestik eckig, wirkt gehemmt, oft verkrampfen sich auch die Finger und ganz besonders wird der freie Atemstrom behindert – es geschieht also alles das, was wir als Schauspieler überhaupt nicht brauchen können. Die erste, scheinbar paradoxe Grundregel der Schauspielkunst muß folglich lauten: Der Schauspieler muß zeitweilig seinen Verstand verlieren!Nur dann kann es uns gelingen, den Körper vollkommen zu entkrampfen und so frei beweglich zu machen, daß er sich dem Rollencharakter anpassen kann. Da wir modernen Menschen alle mehr oder weniger ausgeprägte Verstandesmenschen sind, liegt hier gerade die allergrößte Hürde für unsere künstlerische Entfaltung. Solange wir in unserem Verstand befangen bleiben, stehen wir uns selbst unweigerlich im Wege! Die zweite Grundregel der Schauspielkunst scheint noch paradoxer zu sein: Der Schauspieler muß zeitweilig seine Sprache verlieren.Näher besehen, ist auch das ganz klar. In der frühen Kindheit haben wir unsere Sprache durch Nachahmung von unseren Eltern und anderen Menschen, die uns umgaben, gelernt. Unserer Sprache haften schon alleine dadurch bestimmte charakteristische Eigentümlichkeiten an. Da ist etwa das schwere "Meidlinger" »L«, das breite "beißerische" »E« des modernen Wiener Dialekts, da sind die harten, ganz im Rachen steckenden Konsonanten des Tirolerischen, die weichen, vokalischen Laute im Kärtnerischen, das knappe und abgehakte Berlinerische, das charakteristische »R« der Bayern usw. Dazu kommt unsere eigenes Grundtemperament, das für einen bewegteren oder müderen, für einen klareren oder verschwommeneren Redefluß sorgt. Hinzu kommt – wieder einmal – unser Verstand, der uns dazu drängt, durch die Sprache vorwiegend Gedanken vermitteln zu wollen. Viele scheinen ja heute überhaupt zu glauben, daß das der einzige Zweck des Sprechens ist: Gedanken, oder, noch schlimmer, abstrakte »Informationen« zu transportieren. Der Verstand macht die Sprache monoton, zergliedert sie in einzelne Phrasen, in Sätze und Absätze, an denen der lebendige Redefluß zerbricht – man beachte nur, wie sehr wir dazu neigen, die Sprache am Ende eines Satzes, oft sogar schon am Ende einer Verszeile auf den Punkt hin zu senken. Das Sprechtempo variiert ebensowenig wie die Tonhöhe; höchstens werden noch einige Begriffe, die wir für wichtig erachten, besonders betont. Was wir derart von uns geben, mag durchaus sehr gescheit sein, aber es ist zugleich für das Publikum fürchterlich langweilig und anstrengend zu verfolgen und wird bei den Zuhören genau das bewirken, was auch meist bei faden Vorträgen geschieht: das Publikum wird sanft entschlummern! Die Sprache sinkt dadurch zum bloßen Diener des Verstandes herab, der in Wahrheit, so wie er sich heute darstellt, nur ein kümmerliches Destillat der viel größeren Weisheit ist, die in der Sprache selbst lebt. Tatsächlich hat ja Aristoteles, der Begründer des logischen Verstandesdenkens, die Logik der Sprache abgerungen. »Logos« heißt bekanntlich im Griechischen »Wort«, und die Logik ist nichts anderes als eine Beschreibung des grammatikalischen Satzbaues und der geordneten Satzfolge, die die Menschheit schon lange beherrschte, ehe sie sich des abstrakten Verstandes bewußt geworden ist. Und die »Kategorienlehre« des Aristoteles, die Mutter aller schematischen Verstandeseinteilungen, spiegelt nichts anderes wieder als die zehn verschiedenen Wortarten (Substantiv, Verbum usw.) der griechischen Sprache. Damit ist nichts gegen den Verstand gesagt, den wir natürlich als moderne Menschen unbedingt brauchen, und der uns auch einen Teil der in der Sprache für uns zunächst unbewußt waltenden Gesetzmäßigkeiten bewußt und dadurch frei verfügbar gemacht hat, aber als Künstler brauchen wir mehr. Wir müssen die volle Weisheit der Sprache ausschöpfen – und die überragt unseren winzigen Verstand beiweiten. Kein Mensch hätte die Sprache bewußt mit seinem Verstand »konstruieren« können, wir haben vielmehr alle unseren Verstand der Sprache abgelauscht. Darum lernt ja auch das Kind zuerst sprechen und dann erst denken! Für den Schauspieler gilt jedenfalls ganz unbedingt: wir sollen nicht versuchen, die Sprache durch unseren Verstand zu belehren, sondern wir müssen von der Sprache selbst belehrt werden. Das wirkt, nebenbei bemerkt, wenn man es nur genügend bewußt erlebt, recht förderlich und kräftigend auf den eigenen Verstand zurück. Man wird bald bemerken können, daß die fortgesetzte intensive Arbeit mit der Sprache unser Denken treffsicherer und entschlossener macht. Es geht uns dann nicht mehr so leicht wie Shakespeares Hamlet, der feststellen muß: "der angebornen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt; und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck, durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen." (Hamlet III/1) In Griechenland, der Wiege des philosophischen, ja überhaupt des abendländischen Denkens, hat man daher stets das philosophische Gespräch gepflegt, und man hat sich seine wesentlichsten Gedanken nicht einfach alleine daheim im stillen Kämmerchen gemacht. Platon hat deshalb sogar seine philosophischen Schriften in Dialogform verfaßt, und Aristoteles führt immerhin noch ein fiktives Gespräch mit seinem Leser. Dabei muß man sich auch gleich darüber klar sein, wie man in griechischer Zeit bis hinein in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte gelesen hat: man hat nämlich niemals den Text bloß leise lesend gedanklich aufgenommen, sondern man hat ihn überhaupt nur laut rezitierend erfaßt. Augustinus, der frühchristliche Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, berichtet noch als ein Schüler des Bischofs Ambrosius ganz erstaunt, daß er diesen stumm lesend an seinem Pult angetroffen habe, und er rätselte darüber, wie denn das überhaupt möglich wäre! (Augustinus) Übrigens, weil gerade das Wort »Pult« gefallen ist: man hat in dieser Zeit auch niemals sitzend gelesen, sondern immer nur stehend, und man hat auch seine Gedanken niemals sitzend entwickelt, sondern stehend oder, noch häufiger, gehend. Deswegen hießen auch die Schüler des Aristoteles »Peripatetiker«, die »Herumwandelnden«. Der griechische Verstand entwickelte sich eben nicht nur aus der Sprache, sondern überhaupt aus der ganzen lebendigen Körperbewegung, und er war daher auch ganz anders als unser modernes Denken, das sich ganz im Kopf konzentriert und den restlichen Körper weitgehend ablähmt. Aristoteles hat noch ganz selbstverständlich angenommen, daß das zentrale Organ des Denkens das menschliche Herz sei, womit er für seine Zeit durchaus recht hatte, während dem Gehirn lediglich die Funktion eines raffinierten »Blutkühlers« zukomme - was übrigens tatsächlich eine der phantastischsten Leistungen des Gehirns ist: das Gehirn verbraucht nämlich selbst im Schlaf beinahe ein Viertel unserer ganzen Stoffwechselenergie alleine um seine komplexe Struktur, die beständig abzusterben droht, aufrecht zu erhalten; die dabei unvermeidlich auftretende überschüssige Wärme muß sehr effektiv abgeleitet werden. Unser modernes Verstandesdenken bedient sich allerdings tatsächlich fast ausschließlich des Gehirns als Denkwerkzeug – und gerade darum ist der Verstand dem Schauspieler im Wege! Er soll ja seine Rolle nicht »verhirnen« oder »verkopfen«, sondern verkörpern. Inspiriertes Spiel ist mit unserer Alltagssprache nicht möglich, dazu ist sie zu sehr durch unsere Persönlichkeit korrumpiert. Unsere Sprache müssen wir also loswerden, um später eine neue gewinnen zu können. Natürlich müssen wir nicht gleich unsere ganze Muttersprache verlieren und stumm wie die Fische werden, aber unsere Sprechgewohnheiten, durch die wir unsere Muttersprache zum Spiegelbild unserer Persönlichkeit machen, müssen wir ablegen. Wir müssen, aber mit dem voll wachen Bewußtsein des Erwachsenen, wieder in jene Phase der Kindheit zurückkehren, in der wir ganz spielerisch unsere Sprache erlernt haben. Wir müssen wieder lernen, spielerisch mit den Lauten umzugehen, und die Freude am Spiel muß unsere Übungen leiten:
Wir müssen unsere ganze einseitig verhärtete Alltagssprache zu einer lebendig beweglichen Lautwelt aufschmelzen, aus der die Worte neu geboren werden. Kein Begriff darf uns dabei hindern; wir müssen »vergessen«, was die Worte bedeuten, d.h., worauf sie bloß hindeuten, und sollen sie selbst unmittelbar in ihrem Werden erleben. In allen nachfolgenden Sprachübungen geht es primär um dieses reine Laut- und Worterlebnis, um die reine Sprache, um die vom Begriff befreite Sprache. Das Kind lernt ja normalerweise auch erst zu sprechen und dann zu denken. Es wendet die ersten einsilbigen Worte, die es sich mühsam bildet, auf alles mögliche passende und unpassende an und kümmert sich nicht im geringsten darum, was sie bedeuten. Es hat einfach eine himmlische Freude daran, sich zu artikulieren; es musiziert und plastiziert mit den Lauten in einem ganz natürlichen Spiel und versucht die Wortgebilde nachzubilden, die ihm seine Umgebung zuträgt. Das kleine Kind ist ein wahrer Meister der völlig naiven Nachahmung – der Künstler muß sich etwas von dieser Fähigkeit für das spätere Leben bewahren – dann ist er ein Naturtalent – oder er muß sie, weil sie durch unser modernes Leben verschüttet wurde, mühsam aus der Tiefe seines Wesens wiedergewinnen. Dort schlummert sie nämlich ganz sicher; unsere Übungen sollen helfen, dahin vorzudringen.
Gelingt das, dann schöpfen wir unmittelbar aus dem Urquell der menschlichen Sprache und wir werden jedes einzelne Wort, jede Silbe, ja jeden einzelnen Laut – das sei ganz ohne Übertreibung gesagt – wie ein ganz unglaubliches Wunder erleben, das sich erstmals vor unserem Bewußtsein entfaltet. Das unterscheidet uns nämlich doch von den Kindern, daß diese die Sprache schlafwandlerisch, beinahe unbewußt erlernen, während wir als Künstler diesen Prozeß voll bewußt erleben können. Dann geht aber eine völlig neue Welt, die uns immer wieder neue Überraschungen bringt, vor unserem Bewußtsein auf. Eine Welt, die dem Alltagsmenschen so unbekannt ist, daß er nicht einmal vage ahnt, daß sie existiert. Dieses Erlebnis, das man an der Sprache haben kann, und als Künstler auch haben sollte, ist mindestens so dramatisch und aufregend, wie wenn ein Blindgeborener nach einer erfolgreichen Operation erstmals die Farbenwelt erlebt! Tatsächlich sind wir als Alltagsmenschen blind für die verborgene Lichtwelt der sprachbildenden Kräfte. Ich gebrauche die Lichtmetapher ganz bewußt, denn man hört dann nicht mehr allein die Worte, man sieht sie rein seelisch in ihrer Form- und Farbenvielfalt. Wir sprechen ja auch so von hellen oder dunklen, harten oder weichen Lauten und denken uns nicht viel dabei. Für den Sprachkünstler wird das und mehr zum ganz realen seelischen Erlebnis. Ganz besonders wird jedes Wort, jeder Laut, ganz besonders jeder Vokal von einem ganzen Schwall von Gefühlen begleitet werden, die aber nun nicht mehr unsere persönlichen Gefühle sind, sondern aus denen eine gleichsam objektive Gefühlswelt spricht, die mit den tieferen Schichten der Sprache untrennbar verbunden ist und von der unsere persönlichen Gefühle nur ein matter einseitiger Abglanz sind. Diese objektive Gefühlswelt steht uns aber dann auch für die Rollengestaltung zur Verfügung, und aus ihr dürfen wir ungehemmt schöpfen – oder besser gesagt: der Rollencharakter, der in uns lebt, wird selbsttätig das daraus entnehmen, was ihm angemessen ist. Wir müssen uns überhaupt nicht überlegen, wie wir die Rolle sprechen sollen, sie sorgt schon selbst dafür, wenn wir nur zäh genug unsere Übungen machen. Die gehören nämlich für den Schauspieler ebenso zum täglichen Leben wie für den Klavierspieler seine Fingerübungen. Lassen wir uns doch einfach davon überraschen, wie unser Rollencharakter allmählich selbstständig sprechen lernt! Seien wir einfach wachsamer, aber stiller Zuschauer dessen, was sich in uns entfaltet – wir haben dazu zweifellos den besten Logenplatz! Natürlich gehört Mut dazu; man muß einfach fest darauf vertrauen, daß das Nötige entstehen wird – dann wird es auch entstehen. Man sollte die Schöpferkraft der Sprache nicht unterschätzen; sie wird alles viel besser zustande bringen als wir es uns jemals ausdenken könnten. Nur so kann man zu einem wirklich inspirierten Spiel kommen. Und den Ausdruck »inspiriert« darf man dabei ganz wörtlich nehmen: "Inspiration" heißt "Einatmung" – und das richtige Atmen ist die Grundvoraussetzung der künstlerischen Sprache. Die Atmung öffnet den Körper derart, daß er zum tauglichen Werkzeug des künstlerischen Erlebens und Gestaltens werden kann. Die richtige Atmung führt uns vom bloßen Kopfbewußtsein zu einem leisen Körperbewußtsein hin, das für den Schauspieler ganz wesentlich ist. Der abstrakte Verstand hingegen hemmt den harmonischen Atemstrom und fesselt unser Bewußtsein in der Kopfregion, an der der Körper, kraß gesprochen, wie ein hölzerner Klotz hängt. Wer nur aufmerksam genug ist, kann erleben, wie jeder einzelne abstrakte Begriff, den er sich bildet, ganz leise den Atemrhythmus und weiter sogar den Bewegungsrhythmus der Gliedmaßen hemmt. Das liegt an der schon angesprochenen Muskelverkrampfung, die mit jeder rein intellektuellen Tätigkeit notwendig verbunden ist. Wir können uns nämlich überhaupt nur dadurch scharf umgrenzte abstrakte Begriffe bilden, daß der Kopf, das Denkwerkzeug, so weit als nur irgend möglich ruhig gestellt wird. Und das geschieht eben dadurch, daß sich der Körper zum steifen Gerüst verfestigt, dessen einzige Aufgabe darin besteht, den Kopf ruhig zu tragen. Nur dadurch wird unser Seelenleben so unbeweglich, daß es in einzelne streng von einander gesonderte abgegrenzte starre Begriffe zerfällt, die wie tote Gegenstände frei miteinander kombiniert und in eine unverrückbare logische Folge gebracht werden können. Inhaltlich umfassen diese Begriffe nur das, was wir ihnen durch strenge Definition zugestehen, und innerhalb dieser definierten Grenze werden sie festgehalten und dürfen sich selbsttätig nicht weiterentwickeln. Der abstrakte Verstand zerschneidet die Welt, indem er zugleich alle Sinnesqualitäten, alle Gefühle usw. aussondert, in einzelne Teile, aus denen er sich anschließend wie bei einem Puzzlespiel ein abstraktes, von allen Wahrnehmungsqualitäten befreites Abbild der Welt rekonstruiert. Wesentliche daran ist, daß dieses Bild einzig und allein durch unsere eigene bewußte Verstandestätigkeit zustande kommt, und alle Kräfte, die aus dem Unbewußten aufsteigen könnten, streng ausgeschieden werden. Wir haben es dann nur mit unserer eigenen vollbewußten geistigen Tätigkeit zu tun: gerade das hat aber unser Persönlichkeitsbewußtsein extrem gesteigert. Der Grieche hat, wie wir gesehen haben, noch nicht so gedacht – und eben darum hat er sich auch noch nicht so sehr als einzelne auf sich gestellte Persönlichkeit empfunden wie der heutige Mensch. Er fühlte sich noch vielmehr als Mitglied einer sozialen Gemeinschaft, der Polis, denn als einzelner Mensch. Ein gewisses kollektives Erleben, wie es die Menschheit früherer Jahrtausend überhaupt gekennzeichnet hat, war ihm noch eigen, aber er spürte immerhin schon sehr stark in sich das Verlangen, eine eigenständige Persönlichkeit zu werden, was immerhin dann bei den Römern schon viel stärker gelang, aber erst wirklich in der späteren Neuzeit so richtig zum Durchbruch kam. Wir sehen also, was wir durch den Verstand gewonnen haben: das Bewußtsein, eine eigene Persönlichkeit zu sein, die allein auf sich selbst gestellt, frei für sich entscheiden kann. Darum konnte der französische Philosoph René Descartes begeistert ausrufen: "Ich denke, also bin ich." Hier liegt auch die Wurzel aller modernen Demokratiebestrebungen: das Volk soll zu einer Versammlung freier Persönlichkeiten werden, die gemeinsam die Zukunft gemäß ihren persönlichen Wünschen, die sie miteinander absprechen, gestalten wollen. Die griechische Demokratie hat zwar unsere moderne vorbereitet, unterscheidet sich aber doch noch wesentlich von ihr – man denke nur, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der Grieche seine Sklaven hielt, die, selbst wenn er sie gut behandelte, doch völlig rechtlos waren. Erst der eng mit der lateinischen Sprache verbundene römische Verstand hat ein Rechtssystem geschaffen, das mit der einzelnen Persönlichkeit, mit dem einzelnen Bürger rechnet, und dieses römische Rechtssystem wirkt über den Umweg über das römisch-katholische Kirchenrecht bis in unsere moderne Staatsgrundlage nach.
Der Verstand macht den Menschen erst zur bewußt eigenständigen Persönlichkeit. Man kann das Wort "Verstand" geradezu so auffassen, daß dadurch der Mensch gelernt hat, fest auf sich selbst zu stehen – und das begründet zugleich den persönlichen Egoismus, und er beginnt gerade im römischen Kulturkreis. Vorher gab es ihn in dieser Art kaum, sondern nur einen überpersönlichen Egoismus, der seine Wurzeln im kollektiven Erleben der Menschen hatte. Was irgend einem Mitglied des Kollektivs angetan wurde, das verspürte man unmittelbar so als wäre es einem selbst geschehen, so wie wir es heute ziemlich gleich schlimm empfinden, wenn uns jemand ins Gesicht oder in den Magen schlägt. Die Schuld oder Unschuld des einzelnen Menschen kam dabei überhaupt nicht in Betracht. Was eine Familie der anderen antat, das mußte an der anderen Familie gerächt werden, egal wen es dort traf. Darin gründet sich das Prinzip der Blutrache, das da und dort bis in die heutige Zeit nachwirkt (man denke nur an die Bedeutung der "Familie" in den mafiosen Vereinigungen). Das gilt ganz besonders auch noch für die frühgriechische Zeit, in der sich der einzelne Mensch vorwiegend als Glied der Familie, des Stammes oder Volkes empfand. Man empfand das Kollektiv als eine Art Überpersönlichkeit; und der Stammesführer, der König, war der, der am besten artikulieren und durchsetzen konnte, was in diesem kollektiven Bewußtsein an Bedürfnissen lebte, und was das Kollektiv an Taten setzte, war eben der Wille dieser kollektiven Überpersönlichkeit – darin liegt eine der Wurzeln der griechischen Götteranschauung: Was man auch tat, ob man Kriege gegen andere Stämme oder Völker führte, ob man Rache nahm – man tat es in göttlichem Auftrag; das wird noch in den homerischen Epen sehr deutlich und beginnt erst in der klassischen Zeit allmählich zurückzutreten. Immerhin empfanden noch die Athener die Göttin Athene ganz selbstverständlich als ihre Stadtgöttin. Ursprünglich gründen alle diese Kollektive in der Blutsverwandtschaft. Etwas davon wirkt noch nach, wenn eine Mutter das Leid, das einem ihrer Kinder zugefügt wird, unmittelbar wie ihr eigenes verspürt. Je mehr die Stämme zu Völkern zusammenwuchsen, desto mehr trat die reine Blutsbindung zurück; was jetzt das Kollektiv vorallem verband, war die gemeinsame Sprache. Sprache ist ja immer überpersönlich, eine reine Privatsprache des einzelnen kann es nicht geben. Auch über einzelne Völker hinausragende religiöse Gemeinschaften sind ganz wesentlich von einer gemeinsamen Sprache bestimmt – man denke nur, was die Lateinische Sprache für die katholische Kirche bedeutet hat oder das Arabische noch heute für den Islam. Diese religiösen Gemeinschaften stellen auch ganz deutlich das Kollektiv über die Einzelpersönlichkeit, die letztlich als ihr dienendes Glied aufgefaßt wird. Und Luther hat gerade dadurch am wirksamsten gegen diesen kollektivistischen Katholizismus protestiert, daß er die Bibel ins Deutsche übersetzte.
Das zu bedenken, kann dem Schauspieler hilfreich sein, der sich durch seine Rolle ins griechische Zeitalter zurückversetzen muß. Er muß sich dann in eine Zeit einleben, in der die Sprache noch wenig vom Intellekt beeinflußt, aber dafür umso mehr vom Gefühl getragen ist. Er muß den Schritt vom intellectus zum pathos finden, d.h. zum ehrlich erlebten Gefühl, das aber niemals gemacht erscheinen darf, weil es sonst zum falschen Pathos wird, das den Zuseher zurecht abstößt. Gemacht wirkt es immer, wenn wir verstandesmäßig nach dem Inhalt des Textes entscheiden, daß nun ein bestimmtes Gefühl angebracht wäre und dann so tun als ob wir es auch hätten – dann ist es geheucheltes Gefühl. Das echte Gefühl wird von selbst entstehen, wenn wir nur die Sprache stark genug aus dem lebendigen Atemstrom empfinden. Dann lassen die Laute aus ihrem wechselnden Rhythmus heraus von selbst das ihnen entsprechende Gefühl entstehen. Es steigt dann so in uns auf, daß wir selbst davon überrascht werden – und dann wirkt es auch, weil es wirklich spontan erlebt ist. Auch im alltäglichen Leben fassen wir ja nicht zuerst den Entschluß etwa traurig zu sein, und bemühen uns anschließend diese Stimmung aus uns herauszuholen, sondern das Gefühl entsteht von selbst und wir müssen es zur Kenntnis nehmen – auch dann, wenn es uns vielleicht gar nicht angenehm ist. Schmerzliche Gefühle würden wir dann wohl kaum in uns erregen. Das unterscheidet eben das Gefühlsleben wesentlich von unserer Verstandestätigkeit, daß wir unsere abstrakte Begriffsbildung vollkommen selbst beherrschen, die Gefühle aber nicht in gleichem Maße. Gefühle müssen wir zunächst so nehmen wie sie kommen, aber der Verstand kann uns helfen, nicht von ihnen überrollt zu werden. Die Sprache kann uns als Schauspieler helfen echte Gefühle in uns entstehen zu lassen, weil die Sprache letztlich nichts anderes ist als gestalteter Atem, und weil andererseits die Atmungsorgane wiederum das unmittelbare körperliche Werkzeug des Gefühlslebens sind. Man kann ja leicht bemerken, das jede Veränderung oder Beeinträchtigung der Atmung sofort starke Gefühle auslöst. Atembeklemmung etwa ist unmittelbar mit einem starken Angstgefühl verbunden, umgekehrt regt ein seelisches Hochgefühl sofort den Atem und auch den Pulsschlag an. Unser rhythmisches System, also vorallem die Atmungs- und Kreislauforgane, sind rein körperlich das Zentrum des Gefühlslebens, ebenso wie das Gehirn das Zentrum des abstrakten Denkens ist. Jeder Vokal, der in unserer Sprache erklingt, löst ganz leise eine bestimmte Stimmung aus, und jeder Konsonant modifiziert sie auf charakteristische Weise. Wenn man die Melodie, den Rhythmus und die Harmonien der einander folgenden Laute erfaßt und dabei ganz von der Wortbedeutung absieht, dann beginnt man die Sprache als Musik zu erleben. In dieser in der Sprache verborgenen Musik lebt sich aber unmittelbar das Gefühl aus. Genau das haben die großen Komponisten gespürt, wenn sie Gedichte vertont haben. Die Wortbedeutung war ihnen unwesentlich, Begriffe kann ja die Musik nicht vermitteln, aber das dahinterstehende Gewoge der Gefühle wollten sie durch ihre Musik offenlegen. In der Musik offenbart sich eben unmittelbar, was in der Sprache nur verborgen ruht. Damit der Sprachkünstler die Musik der Sprache erleben kann, dazu muß er zwar kein Musiker sein, aber er muß die Sprache so lebendig gestalten, daß sie in den wechselnden Tonhöhen und Tempi tatsächlich in Gefühlstönen zu klingen beginnt. Düstere dunkle Laute, die man bis tief in den Unterleib hinein spürt; helle Vokale, die in den Schädelknochen widerklingen; das Stakkato harter Konsonanten, die blitzschnell aufeinander folgen – all das entrollt vor unserer Seele ein ganzes Gefühlsdrama, das sich hinter dem begrifflichen Inhalt des Textes verbirgt, und durch das wir unmittelbar ins Seeleninnerste des Rollencharakters blicken und ihn zugleich dem Publikum fühlbar machen. Im Alltagsleben können wir nicht ins Innerste unserer Mitmenschen schauen – im Rollencharakter stehen wir mittendrinnen: und wenn wir nur stark genug die Sprache in uns wirken lassen, so daß sie zur Musik wird, dann kann auch das Publikum an diesem Erlebnis teilnehmen. Wir erreichen dann das Publikum nicht nur auf der Verstandesebene, sondern wir machen die, die uns zusehen, zu echten Mitfühlenden.
Und noch ein Drittes ist nötig: auch der Wille muß sich unmittelbar dem Publikum gegenüber aussprechen. Der Wille lebt in allem, was wir tun. Er zeigt sich in der kleinsten Fingerbewegung, in der Gestik unserer Arme, in einem flüchtigen Blick, in der Art wie wir gehen, etwa darin, ob wir fest mit der Ferse auftreten oder leichtfüßig über den Boden huschen. Überhaupt zeigt sich die Willenscharakteristik unserer Persönlichkeit in der ganzen Körperhaltung. Ob wir aufrecht stehen oder mit leicht gekrümmtem Rücken, ob wir häufig leise den Kopf senken oder ihn häufig zurückwerfen, ob unsere Schultern eingesunken sind oder wir mit leichtem Hohlkreuz durch die Welt marschieren – all das gibt ein lebendiges Bild unserer Persönlichkeit, das für den, der es zu lesen vermag, viel mehr aussagt als das, was wir an Meinungen und Gedanken äußern. In der Körperhaltung zeigt sich nämlich unmittelbar unser Können, nicht unser Wissen, unsere Fähigkeit, wirklich etwas zu tun – denn der Gedanke allein, sei er auch noch so klug, vollbringt noch nichts. Der Wille ist es, der ihn zur Tat werden läßt. Der Wille bestimmt, ob wir auch unser Wissen in Taten umsetzen können – und dieser Wille spricht sich in unserer ganzen Gestalt aus. Sie ist ein Spiegelbild der verborgensten Seiten unserer Persönlichkeit: unserer Persönlichkeit, wohlgemerkt – und die wollen wir ja gerade nicht auf der Bühne darstellen, sondern eine ganz andere, nämlich den Rollencharakter. Darauf haben wir ja schon hingewiesen: Wir müssen unsere natürliche Bewegungsgestalt aufgeben, überwinden, und dafür eine neue gewinnen. Daher gilt als dritte Grundregel der Schauspielkunst: Der Schauspieler muß zeitweilig seine ganze bewegte Gestalt verlieren.
Alle Übungen zum Rollenspiel, namentlich auch die Temperamentsübungen sollen dahin führen, daß unsere ganze Gestalt so beweglich wird, daß wir uns so weit als nur möglich von unseren Bewegungsgewohnheiten und von unserer natürlichen Körperhaltung befreien, so daß dadurch Raum geschaffen wird für den Rollencharakter, der sich verkörpern will. Jede kleinste Geste, durch die unsere Persönlichkeit durchleuchtet, stört den Bühnencharakter. Hier müssen wir ganz frei von uns selbst werden. Und hier ist es zugleich auch am allerschwersten, denn wie wir gehen, wie wir unsere Gesten machen, wie wir schauen, dessen sind wir uns am allerwenigsten bewußt. Zwar zeigt sich gerade in unserer bewegten Gestalt unsere Individualität am aller deutlichsten – nur nicht für uns selbst. Denn alle anderen können uns von außen bei unseren Bewegungen zusehen und mit verständigem Blick daraus sehr viel ablesen – nur just wir selbst können uns von außen nicht anschauen. Da hilft im Grunde auch kein Spiegel, denn den können wir nicht beständig mit uns herumführen, und außerdem verändert der beständige Blick in den Spiegel unser ganzes Tun so stark, daß sich daraus wieder nichts vernünftiges ergibt. Auch Video und Film können uns nicht wirklich helfen, weil sie uns erstens kein reales räumliches Erleben vermitteln – und gerade auf die Bewegungsformen im Raum kommt es an – und weil sie uns nur einen stark verzerrten Eindruck liefern, indem sie manche Details kraß überbetonen und andere wiederum stark unterdrücken. Das einzige, was wirklich helfen kann, ist, daß wir unser Bewußtsein für die Feinheiten unserer Körperbewegungen erwecken und sie dadurch gleichsam von innen her objektiv erleben können. Dazu sollen unsere Übungen dienen. Und wenn wir uns derart unserer Körpersprache, die eigentlich eine Seelensprache ist, bewußt werden, dann wird das auch das beste Mittel sein, daß wir unsere persönlichen Eigenheiten loswerden, denn eines wird man bald bemerken: wenn man das, was man sonst unbewußt tut, plötzlich ganz bewußt ausführen soll, dann funktioniert auf einmal gar nichts mehr! Unsere ganze Gestik, unsere ganze Körperhaltung wird vollkommen durcheinander kommen – und das ist gut so; nicht als endgültiges Ziel unserer Übungen, aber als notwendiges Durchgangsstadium! Ähnliches wird man übrigens auch schon bei den Sprachübungen bemerken. Auch da kommt normalerweise eine Phase, wo man mit der Sprache nicht mehr zurecht kommt, wo man plötzlich über Worte stolpert, die einem vorher keine Mühe bereitet haben. Das zeigt, daß man die Übungen richtig gemacht hat und daß sie nun zu wirken beginnen und unsere Sprache bald fähig sein wird, sich wirklich zu verwandeln. Ganz ähnlich ist es mit unserer Körpersprache. Ein bißchen davon merkt man ja schon, wenn man zum aller ersten Mal auf der Bühne steht. Dann wirken meist schon die einfachsten Schritte und Handbewegungen recht unbeholfen. Ganz instinktiv will man sich nämlich nicht vor aller Augen zur Schau stellen, man will eigentlich unbewußt seine Bewegungsgewohnheiten verstecken, sie zeitweilig loswerden; jede Bewegung wirkt gehemmt und zurückhaltend, weil zugleich auch noch nicht zu einer neuen Bewegungsform hinfindet. Das, was sich natürlicherweise ankündigt, muß ganz einfach durch die Übungen verstärkt und weitergeführt werden. Und wenn wir dann uns selbst losgeworden sind, und wenn wir dann endlich genügend beweglich geworden sind, dann kann sich der Rollencharakter wirklich unseres Körpers bemächtigen und sich selbst verkörpern. Wie er sich schließlich verkörpern wird, dazu brauchen wir gar nichts mehr tun, davon dürfen wir uns getrost überraschen lassen. Damit haben wir eigentlich das Ziel aller Schauspielkunst erreicht: wir haben eine Rolle glaubhaft verkörpert.
Mehr als unserer drei Grundregeln bedarf es dazu nicht, aber wir leisten damit zugleich das schwierigste, was man als Mensch überhaupt leisten kann: Selbstüberwindung. Das wird uns wohl niemals vollkommen gelingen, aber jeder Schritt in diese Richtung bringt uns weiter. Wir kehren gewissermaßen mit einem Teil unseres Wesens in den Embryonalzustand zurück und lassen daraus einen neuen zweiten Menschen in uns heranwachsen. Wir gehen schwanger mit der Rolle, und der erlernte Rollentext und unsere beständigen Übungen sind die Nahrung, die den Rollencharakter wachsen und reifen läßt, bis er eigenständig gehen, sprechen und denken lernt. Und in dem Maße, in dem wir uns für die Rolle derart selbst überwinden, gewinnen wir uns zugleich selbst ein bißchen reifer zurück.
Literatur:[1]Rudolf
Steiner, Aphoristische Ausführungen über Sprachgestaltung und dramatische
Kunst, abgedruckt in Rudolf Steiner, Methodik und Wesen der Sprachgestaltung,
GA 280 (1983) zurück zum Anfang
|
||||||||||||